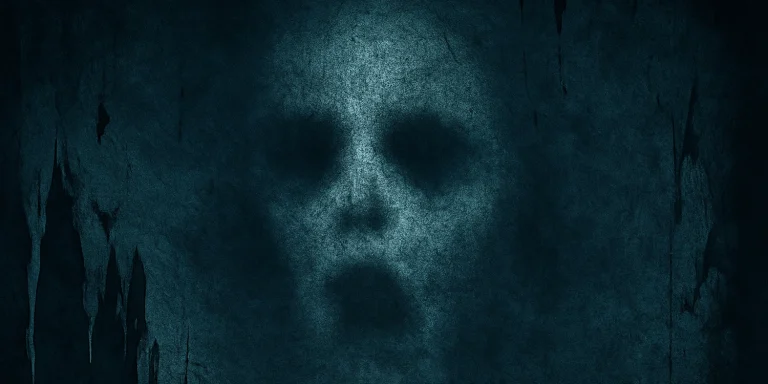Einleitung
Als Grave (Raw) im Jahr 2016 in die Kinos kam, vernahm ich ausschliesslich Lob. Ein Vertreter der New French Extremity (wikipedia), der dem Publikum an die Nieren gehen sollte. Doch es verging ein weiteres Jahr, bis ich mir die Blu-ray zulegte, und selbst dann blieb sie noch monatelang ungesehen im Regal liegen. Als ich mich schliesslich überwinden konnte, war es Liebe auf den ersten Blick. Seither zählt dieses kleine Juwel zu meinen absoluten Lieblingsfilmen.
War Grave (Raw) ein Lucky Punch? Nein. Titane beweist, dass Ducournau keine Eintagsfliege ist, sondern eine der eigenständigsten Stimmen des zeitgenössischen Kinos. Ihre Filme sind fordernd, aber ehrlich. Brutal, aber voller Herz. Sie machen Angst, jedoch nie aus der falschen Motivation. Wer sich darauf einlässt, wird nicht nur gefordert, sondern auch reich belohnt. Mit ihrem neuen Film Alpha geht Ducournau diesen Weg konsequent weiter. Dieses Mal richtet sie ihren Blick auf das gesellschaftliche Trauma der AIDS-Krise der 1980er-Jahre und erzählt von Isolation, Fürsorge und der Angst vor dem Fremden. Ich freue mich besonders auf diesen neuen Film, weil Ducournau dem europäischen Kino treu bleibt. Sie begeht damit nicht den Fehler, den ein Pascal Laugier (Martyrs, Ghostland) beging, als er sich stärker am Geschmack des amerikanischen Publikums orientierte, was seiner Radikalität nicht immer guttat.
„Alles entspringt etwas sehr Persönlichem – ich werde Ihnen nicht sagen, was, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich überall in meinen Filmen bin. Keiner von ihnen ist autobiografisch, aber alles entspringt etwas, das ich in mir habe.“
Julia Ducournau @ Villa Albertine
Julia Ducournau – Eckdaten

Geburtsdatum / -ort:
November 1983 / Paris, Frankreich
Ausbildung:
La Fémis (Drehbuchstudium, Abschluss 2008)
Filmgenre:
Body Horror, Drama, Thriller
Aktiver Zeitraum:
2011 – heute
Bekannt für:
Provokative, körperbetonte Filme mit psychologischem Tiefgang
Filmografie
Junior (2011, Kurzfilm), Mange (2012, TV-Film), Raw (Grave, 2016), Titane (2021, Goldene Palme), Alpha (2025)
Auszeichnungen
Palme d’Or (Titane, Cannes Filmfestival 2021), FIPRESCI-Preis (Raw, Cannes Filmfestival 2016), Petit Rail d’Or (Junior, Cannes Filmfestival 2011), People’s Choice Midnight Madness Award (Titane, Toronto International Film Festival 2021), Magritte Award (Titane, 2022)
Herkunft und frühe Prägung
Julia Ducournau wurde 1983 in Paris geboren, als Tochter einer Gynäkologin und eines Dermatologen. Dieses medizinische Umfeld prägte ihre künstlerische Entwicklung von klein auf. Sie wuchs mit Gesprächen über den menschlichen Körper auf, die von einer Mischung aus fachlicher Distanz und emotionaler Offenheit geprägt waren. Diese Haltung übertrug sich auf ihre eigene Sichtweise und führte zu einer tiefen Faszination für Körper, Verletzlichkeit und Transformation. Der Körper wurde für sie nicht nur ein biologisches Objekt, sondern ein Ausdruck von Identität, Konflikt und Wandlung. (https://www.theguardian.com)
Bereits im Alter von sechs Jahren sah Ducournau heimlich den Film The Texas Chainsaw Massacre, was ihre Begeisterung für das Horrorgenre weckte. Zur gleichen Zeit entdeckte sie die Werke (toutelaculture.com) von Edgar Allan Poe. Seine Histoires extraordinaires nennt sie bis heute eine ihrer wichtigsten literarischen Erfahrungen. Die düstere Symbolik und psychologische Tiefe dieser Texte spiegeln sich in der Atmosphäre und Thematik ihrer eigenen Filme deutlich wider.
Einflüsse und Inspirationsquellen
Ein zentraler Einfluss auf ihre filmische Sprache hat der kanadische Regisseur David Cronenberg. Sie bewundert seine Fähigkeit, den Körper als Medium emotionaler und existenzieller Erfahrungen darzustellen. Besonders seine Vision vom Tod als Metamorphose und seine radikale Bildsprache inspirierten sie dazu, gesellschaftliche und psychologische Themen durch Körperdarstellungen filmisch zu erforschen.
Überdies greift sie inhaltlich oft auf philosophische und mythologische Motive zurück. So flossen etwa die griechischen Erzählungen von Gaia und Uranus in die Konzeption von Titane ein. Diese Mythen nutzt sie, um Identität als etwas Fluides und ständig Werdendes zu denken.
Themen und Motive
Ducournau nutzt ihre Filme, um über gesellschaftliche Erwartungen (thefinalgirls.co.uk) nachzudenken. Vor allem die normativen Vorstellungen von Weiblichkeit und Körper werden von ihr aufgebrochen. In Raw und Titane verbindet sie radikale Bildwelten mit intimen Geschichten, um zu zeigen, wie tief die sozialen Zwänge in den Körper eingeschrieben sind. Die Körper ihrer Figuren rebellieren, zerfallen, mutieren. In diesen Veränderungen spiegelt sich ein Akt der Befreiung, aber auch der Schmerz des Andersseins.
Visueller Stil
Visuell ist Ducournau stark von der Malerei und Fotografie beeinflusst. Sie nennt Caravaggio, Winslow Homer und René Magritte als wichtige Inspirationsquellen. Von Caravaggio übernimmt sie die dramatische Lichtführung, die Figuren oft wie in einem religiösen Tableau erscheinen lässt. Bei Homer inspiriert sie die melancholische Stimmung und die Nähe zu einfachen, verletzlichen Menschen. Magrittes surrealistische Bildwelten spiegeln sich in ihren unerwarteten, fast traumartigen Kompositionen wider. Der gezielte Einsatz von Licht und Schatten, von starken Farbkontrasten und ungewöhnlichen Perspektiven dient ihr nicht nur der Ästhetik, sondern auch als Werkzeug, um emotionale Spannungen, Grenzerfahrungen und innere Zerrissenheit sichtbar zu machen.
Quellen: W Magazine, LA Times, Backstage
Jüngste Arbeiten und Ausblick
Ihr jüngster Film Alpha, der 2025 erscheint, verlegt sein Geschehen in die 1980er-Jahre und verbindet Coming-of-Age mit einer düsteren Epidemiegeschichte. Nach dem, was ich bisher darüber gelesen habe, deutet vieles darauf hin, dass Ducournau mit einer fiktiven, körperverändernden Krankheit allegorisch auf die gesellschaftlichen Ängste und das Stigma rund um die AIDS-Krise [bspl. cadenaser.com] anspielt. Den Film selbst habe ich bisher nicht gesehen. Diese Einschätzung bleibt also meine persönliche Theorie, basierend auf ersten Kritiken und Inhaltsangaben. Damit greift Ducournau erneut das Leitmotiv ihres Werks auf: den Körper als Projektionsfläche für kollektive Traumata und als Ort von Verletzung, Transformation und Rebellion.
Fazit
All diese Einflüsse vereinen sich in einem einzigartigen filmischen Stil, der weit über das Genre des Body Horror hinausgeht. Julia Ducournau schafft Werke, die gleichermassen körperlich unmittelbar wie philosophisch vielschichtig sind. In ihren Filmen werden Körper zu Schauplätzen von Identität, Rebellion, Schmerz und Transformation. Dabei geht es ihr nicht um Provokation um der Provokation willen, sondern um eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Abgründen und Möglichkeiten menschlicher Existenz. Sie verknüpft extreme Bildwelten mit zutiefst persönlichen Fragen: Was bedeutet es, anders zu sein? Wo liegen die Grenzen von Identität? Und wie lassen sich Körper, die von der Gesellschaft abgelehnt werden, filmisch zurückerobern?
Auffällig ist dabei, wie subtil sie auch Themen rund um Geschlecht und Sexualität einbindet. Während Hollywood solche Inhalte oft mit dem Holzhammer serviert, beinahe wie eine Faust ins Gesicht, bettet Ducournau sie leise und organisch in ihre Erzählungen ein. So gelingt ihr ein Kino, das verstört, fasziniert und lange nachwirkt.