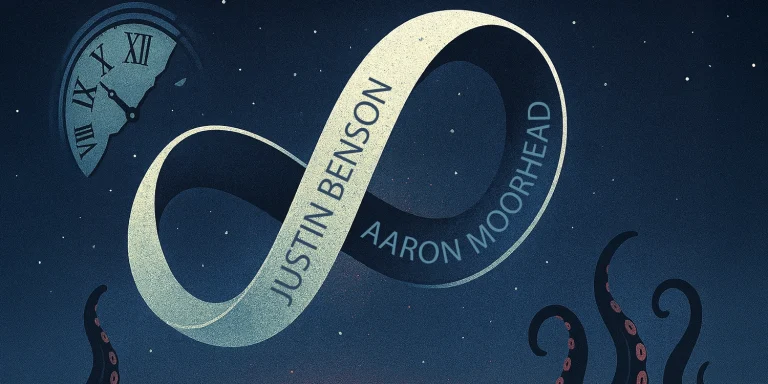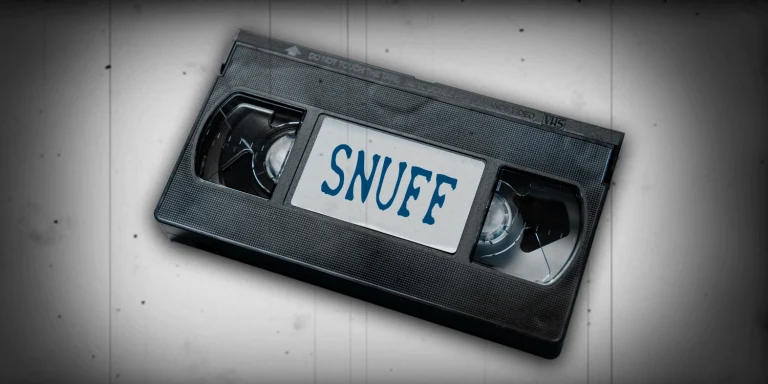Das österreichische Kino liefert nicht vom Fliessband. Es ist kein Hollywood. Es ist nicht einmal ein verlässlicher Lieferant für konstant gute Filme, aber wenn ein Werk einschlägt, dann mit der Wucht eines Vorschlaghammers. Besonders eindrucksvoll wird das dort, wo es sich mit dem Genrekino kreuzt. Horror, Thriller, psychologischer Terror und Groteske erhalten hier eine eigene Färbung. Sie wirken roher, unvorhersehbarer, entschleunigt und oft gerade dadurch umso verstörender.
Die Helden, wenn man sie so nennen will, sind keine strahlenden Cowboys mit sauberem Gewissen, sondern Menschen voller Risse, Widersprüche und Abgründe. Sie retten niemanden, oft nicht einmal sich selbst. Die Erzählungen folgen selten klaren Mustern. Enden bleiben offen, brutal oder einfach leer. Wer sich auf diese Filme einlässt, wird nicht durch Eskapismus unterhalten, sondern durch Konfrontation. Der rote Faden folgt keiner stromlinienförmigen Dramaturgie, sondern windet sich um Erwartungen und Sehgewohnheiten, die uns Hollywood über Jahrzehnte eingeimpft hat. Genau das macht die Wirkung des österreichischen Genrefilms so nachhaltig.
Antihelden und gebrochene Figuren
Im Zentrum stehen selten Identifikationsfiguren. Der klassische Held hat hier keinen Platz. Stattdessen begegnet man Antihelden, Verlorenen, psychisch angeschlagenen oder zerfallenden Familienstrukturen.
Michael Hanekes Funny Games (1997) etwa nimmt die Konventionen des Home-Invasion-Genres auseinander. Eine durchschnittliche Familie gerät in eine Situation, in der Gewalt und Willkür jedes Gefühl von Sicherheit untergraben, ohne erkennbaren Grund. Das Publikum wird zur Komplizenschaft gezwungen, und der Schmerz überträgt sich spürbar über den Bildschirm hinweg.
Ich seh, ich seh (2014) von Veronika Franz und Severin Fiala beginnt als psychologisches Familiendrama und kippt in einen stillen, aber kompromisslosen Horrorfilm, der konsequent eine Atmosphäre der Bedrohung und psychischen Destabilisierung aufrechterhält.
„Ein Horrorfilm? Ein Autorenfilm? Wir wollen, dass unser Film Ich seh, ich seh beides ist. Wir lieben körperliches Kino. Filme, die einen physisch überwältigen. Gleichzeitig wollen wir Fragen stellen, die wir als existenziell empfinden. Fragen über die Realität des Lebens, über Erziehung und Machtverhältnisse in der Familie und vor allem über das Monströse im Menschen. Wir wollten einen Film machen, der etwas über unser Leben aussagt und zugleich nervenaufreibend ist.“
Franz und Fiala auf ulrichseidl.com
Auch Hagazussa (2017) von Lukas Feigelfeld ist ein Genrefilm im engeren Sinn. Die Mischung aus Folk Horror, Psychodrama und alpinem Wahn entfaltet sich in radikalem Erzähltempo. Die Isolation und der innere Zerfall der Hauptfigur spiegeln sich in der Abgeschiedenheit einer alpinen Landschaft und werden zu einem metaphysischen Alptraum, wo Wirklichkeit und Wahnsinn Hand in Hand gehen.
In eine ähnlich düstere Richtung geht Des Teufels Bad (2024), ebenfalls von Veronika Franz und Severin Fiala. Der Film basiert auf dokumentierten Selbstmordfällen unter Frauen im ländlichen Österreich des 18. Jahrhunderts. Statt klassischen Genrehorror zu inszenieren, zeigt er das Grauen des Alltags, das sich in religiösem Wahn und gesellschaftlicher Repression manifestiert. Das Grauen kommt nicht von aussen, sondern wächst aus der Landschaft, aus Erinnerung, Geschichte und Krankheit.
„Wir wollten keinen typischen Horrorfilm machen, sondern einen Film über den inhärenten Schrecken der Existenz.“
Severin Fiala @ Sitges Film Festival
Gerald Kargls Angst (1983) wiederum gehört zu den intensivsten Serienkillerfilmen der Filmgeschichte. Kameraführung, Musik und Perspektive lassen keine Distanz zu. Die Gewalt ist nicht stilisiert, sondern gnadenlos direkt. Der Film verzichtet auf psychologische Erklärungen und bleibt dadurch umso beunruhigender. Er wirkt wie ein düsterer Albtraum, der sich mit jeder Minute tiefer in das Bewusstsein frisst. Der Film wurde in mehreren Ländern wegen seiner kompromisslosen Darstellung von Gewalt verboten.
Warum also sollte man sich überhaupt einen Film ansehen, in dem es keine Helden gibt, keine Hoffnung, kein Licht am Ende des Tunnels?
Weil solche Filme nicht die Welt beschönigen, sondern ihre Risse sichtbar machen. Sie erzählen von dem, was wir lieber verdrängen, wie etwa Kontrollverlust, soziale Kälte oder existenzielle Leere. Und gerade darin liegt ihr Wert. Sie kratzen nicht an der Oberfläche, sie bohren sich hinein, und wer hinschaut, erkennt nicht selten etwas von sich selbst.
Zerfall und Morbidität als Grundrauschen
Was das österreichische Genrekino besonders auszeichnet, ist seine Vorliebe für Morbidität. Sterben, Zerfall, Krankheit und Wahnsinn sind keine Schockeffekte, sondern durchziehen die Erzählung als Grundrauschen. Dazu kommt ein Erzähltempo, das viele abschrecken mag. Die Filme sind oft langsam, mitunter radikal entschleunigt. Die Zeit dehnt sich. Spannung entsteht nicht durch Tempo, sondern durch Auslassung, Stille und die Ahnung, dass etwas schiefläuft, ohne dass man genau sagen kann, wann, wie oder was.
Wer durchhält, wird oft mit fiesen Wendungen und einem unerwarteten Ende belohnt. Der verlangsamte Rhythmus schärft den Blick für Details, und das Aushalten von Stille verleiht vielen dieser Filme eine eigene Art von Horror, selbst wenn sie nicht dem Genre zugeordnet werden.
Kein Bock auf Konventionen
Das österreichische Genrekino macht sich wenig aus Regeln. Ob lineare Handlung, klarer Spannungsbogen oder ein tröstliches Ende, all dies kann fehlen oder wird bewusst unterlaufen. Was vertraut erscheint, wird verdreht, ins Leere geführt oder einfach abgebrochen. Zurück bleibt oft ein schales Gefühl und das Wissen, dass man gerade etwas gesehen hat, das hängenbleibt, aber nicht, weil es sich gut anfühlt.
In Luzifer (2021) etwa geraten Glaube, Wahn und Natur in einen halluzinatorischen Konflikt. Die dämonische Bedrohung bleibt diffus, und der Zuschauer verliert mit der Hauptfigur den Boden unter den Füssen. In Ich seh, ich seh wird das scheinbar klare Spiel zwischen Mutter und Kind in einen psychologischen Albtraum verwandelt, in dem die Frage nach Identität und Realität zunehmend verschwimmt.
Dialekt, Dissonanz und Düsternis
Viele österreichische Genrefilme verzichten bewusst auf Hochsprache. Dialekte dominieren, oft so stark, dass selbst deutschsprachige Zuschauer mit Untertiteln besser bedient sind. Diese sprachliche Eigenheit schafft Authentizität, kann aber für manche fremd oder abweisend wirken.
Dazu kommt ein Tonfall, der oft schwer einzuordnen ist. Ist das noch ernst gemeint oder schon bitterster Sarkasmus. Die Antwort lautet meist beides. Der Humor ist britisch-schwarz, manchmal so trocken, dass er wie Gleichgültigkeit wirkt. Selbst im Grauen lauert oft ein leiser Spott. So etwa in Funny Games, wo das Spiel mit den Erwartungen des Publikums in eine perfide Metaebene kippt. Die Täter durchbrechen die vierte Wand, kommentieren ihr eigenes Handeln und wirken dabei so beiläufig ironisch, dass der Schrecken eine absurde Komponente erhält.
Nihilismus als künstlerisches Programm
Das österreichische Genrekino verweigert sich bewusst der Idee eines versöhnlichen Kinos. Nihilismus steht im Zentrum vieler Erzählungen und prägt deren unversöhnlichen Blick auf das Menschliche. Glückliche Ausgänge oder Erlösung sind die Ausnahme. Was bleibt, ist oft ein offenes Ende, das dem Publikum Raum für eigene Deutungen lässt.
Filme wie Angst oder Ich seh, ich seh zeigen Figuren, die konsequent und unbeirrbar ihren Weg gehen, ohne dass das Narrativ eine moralische Korrektur oder Auflösung anbietet. Statt eines Kompass aus Gut und Böse bleibt dem Publikum nur die Konfrontation mit der Kälte und Konsequenz des Geschehens. Die Kamera bleibt oft distanziert, die Erzählung kalt. In Angst etwa folgt die Kamera dem Täter in langen, ungeschnittenen Einstellungen, teilweise aus Schulterperspektive oder mit Steadicam knapp über seinem Kopf. Diese Nähe, kombiniert mit der völligen Abwesenheit moralischer Kommentare, verstärkt das Gefühl von Entfremdung und Beklemmung. Der Zuschauer bleibt zurück, mit einem Gefühl der Ohnmacht.
Fazit
Das österreichische Genrekino taugt nicht zur Flucht aus der Realität. Es hält einem den Spiegel vors Gesicht. Oft ist dieser Spiegel dunkel und erbarmungslos. Und obwohl man manchmal wegsehen möchte, zieht es einen immer wieder hinein.
Wer einen dieser Filme beginnt, weiss nie, wo er am Ende landet. Oder ob überhaupt. Kein klarer Aufbau, keine Identifikationsfiguren, keine Belohnung. Stattdessen Reibung, Ungewissheit, Leere. Und genau das macht dieses Kino so erfrischend. Es öffnet Räume, in denen nicht alles vorgekaut wird. Es traut dem Publikum zu, den Kontrollverlust nicht nur zu ertragen, sondern etwas daraus mitzunehmen.
Im Vergleich zu Hollywood, wo viele Filme in bekannten Mustern verlaufen und oft in routiniertem Bombast ersticken, wirkt das österreichische Genrekino wie ein kalter Luftzug in einem überhitzten Raum. Es fordert, aber es belohnt nicht mit Antworten, sondern mit Nachhall. Mit Bildern, die nicht mehr verschwinden. Mit Gedanken, die sich nicht einfach so abschütteln lassen.
Man schaut es nicht, um sich besser zu fühlen. Man schaut es, weil man sich traut, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Oder wie sie sein könnten, wenn der Trost wegfällt.