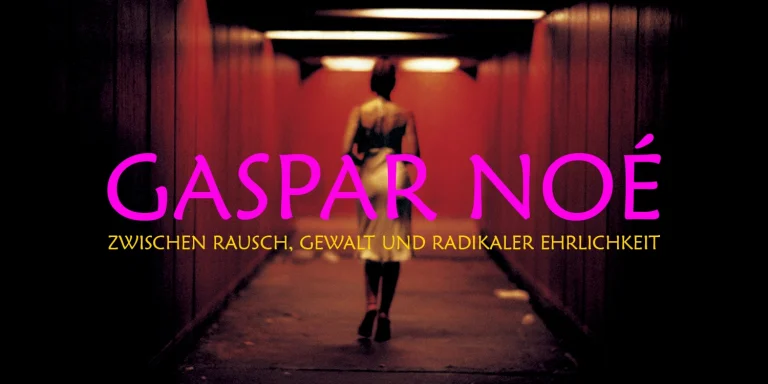Kaum ein Thema im Grenzbereich von Kino, Gewalt und Paranoia ist so langlebig wie der Snuff-Film Mythos. Seit den 1970er-Jahren geistert die Vorstellung durch Medien, dass es Filme gebe, in denen Menschen wirklich vor laufender Kamera getötet werden.
Aber existiert das wirklich? Ich gehe der Frage nach.
Entstehung und Popularisierung des Snuff-Film Mythos
Der Begriff Snuff im Kontext von Filmen tauchte erstmals 1971 in Ed Sanders’ Buch The Family: The Story of Charles Manson’s Dune Buggy Attack Battalion auf [encyclopedia]. Damit war er literarisch bereits eingeführt, bevor ein Film denselben Namen trug.
Einen realen filmischen Bezug gab es im Exploitation-Kino der frühen Siebzigerjahre. Michael und Roberta Findlay drehten 1971 in Argentinien den Low-Budget-Film Slaughter. Das Werk, das lose an die Manson-Morde angelehnt war, fand zunächst keinen Verleih und verschwand beinahe in der Bedeutungslosigkeit [GCBb].
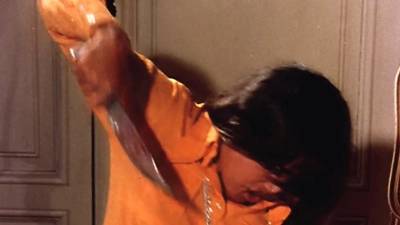
Mitte der Siebzigerjahre kaufte der New Yorker Produzent Allan Shackleton die Rechte am Film. Um Aufmerksamkeit zu erzeugen, liess er 1975 eine zusätzliche Szene drehen, die einen angeblich echten Mord zeigt. Anschliessend veröffentlichte er den Film 1976 unter dem neuen Titel Snuff [Collider].
Das Marketing spielte gezielt mit der Vorstellung, das Publikum sehe am Ende eine echte Tötung. Obwohl dies nachweislich eine gestellte Szene war, sorgte die Kontroverse für Schlagzeilen und verankerte den Begriff Snuff endgültig in der Popkultur.

In den Achtzigerjahren erlebte der Mythos seine Breite durch die VHS. Heimvideokultur war der perfekte Nährboden für Geschichten über verbotene Tapes, die nur unter der Hand kursieren. Auch der Mainstream griff den Stoff auf. 8MM (1999) mit Nicolas Cage erzählt die Geschichte eines Privatdetektivs, der einem angeblichen Snuff-Film nachgeht. Ein Hollywood-Thriller, der den Mythos für das breite Publikum dramatisierte.
Im Horror wurden VHS oder Super 8 zu Symbolen des Verbotenen. In Sinister (2012) entdeckt ein Schriftsteller alte Super-8-Rollen, die wie harmlose Familienfilme wirken, sich dann aber als dokumentierte Morde entpuppen. Genau diese Form der Aufzeichnung erinnert an das, was im Mythos um Snuff-Filme kolportiert wird. Heimlich gefilmte echte Tötungen. Die grobkörnige, analoge Ästhetik verstärkt das Gefühl, etwas Authentisches und Verbotenes zu sehen. The Ring (2002) inszeniert eine mysteriöse Videokassette, die wie ein modernes Snuff-Artefakt wirkt. Eine obskure Collage ohne klaren Urheber, die den Tod jener heraufbeschwört, die sie ansehen. Das Motiv des verbotenen Bildmaterials wird hier direkt mit tödlichen Konsequenzen verknüpft. V/H/S (2012) nutzt die VHS selbst als Medium des Grauens. Viele Episoden zeigen Gewalt und Tötungen aus der Perspektive der Täter, wodurch eine Nähe zu Snuff-Erzählungen entsteht. Die rohe Bildqualität lässt die Gewalt ungeschliffener und realer wirken, als handle es sich tatsächlich um Aufzeichnungen echter Taten. So bleibt VHS oder Super 8 bis heute mehr als Technik. Sie sind dunkle Symbole, Projektionsflächen für die Angst vor Aufnahmen, die niemand sehen sollte.
Zensur als Verstärker des Snuff-Film Mythos
Die staatliche Zensur wirkte wie Brandbeschleuniger für den Snuff-Film Mythos. Verbote und Indizierungen liessen viele glauben, dass es Inhalte gäbe, die so schlimm seien, dass man sie vollständig verstecken müsse. In Deutschland wurden zahlreiche Horrorfilme indiziert oder beschlagnahmt. Tanz der Teufel war über 30 Jahre verboten, erst 2016 kam die Freigabe. 2017 erhielt der ungeschnittene Film eine FSK-Freigabe ab 16. [Fandom, Wikipedia]
Solche Eingriffe nährten das Gefühl, dass es Inhalte gebe, die so schlimm seien, dass man sie komplett verbergen müsse.
In England führte die Video-Nasties-Debatte in den Achtzigerjahren zu einem Verbot von Dutzenden Filmen. Boulevardmedien und Politiker schürten Panik, was die Vorstellung verstärkte, es müsse noch weitaus Schlimmeres im Untergrund existieren. [Wikipedia, BFI]
Wenn schon Fiktion zensiert wird, glauben viele Zuschauer fast automatisch an die Existenz geheimer Filme mit echter Gewalt.
Grenzfälle zwischen Fiktion und Realität
Filme wie Cannibal Holocaust oder Faces of Death zeigten, wie schnell Realität und Fiktion verschwimmen konnten und damit, wie leicht der Snuff-Film Mythos befeuert wurde.

Cannibal Holocaust (1980) gilt als einer der ersten Horrorfilme, die konsequent auf das setzen, was später als Found Footage [The Guardian] bezeichnet wurde. Der Regisseur Ruggero Deodato liess seine Handlung von einem fiktiven Kamerateam erzählen, das im Amazonas verschwindet. Die gefundenen Filmrollen wirken roh und dokumentarisch, was dem Publikum das Gefühl vermittelte, echte Aufnahmen zu sehen. Genau dieses Stilmittel griff später The Blair Witch Project wieder auf und machte es weltbekannt.
Für zusätzlichen Skandal sorgte, dass während der Dreharbeiten mehrere Tiere tatsächlich getötet wurden, darunter eine Schildkröte, ein Affe und ein Nasenbär. Diese Szenen sind real und heben den Film bis heute von anderen Exploitationwerken ab. Kritiker sahen darin eine Grenzüberschreitung, die den Mythos um Cannibal Holocaust eher verstärkte. In mehreren Ländern wurde der Film beschlagnahmt oder zensiert, und Deodato musste sich sogar kurzfristig wegen Mordvorwürfen verantworten, weil man glaubte, die gezeigten Tötungen an Menschen seien echt (The Guardian, Medium).
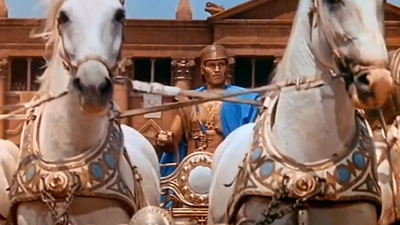
Auch grosse Klassiker des Kinos gingen mit Tieren nicht zimperlich um. In Ben Hur (1959) starben nach zeitgenössischen Berichten mehrere Pferde während der legendären Wagenrennen-Szenen, weil Stunts ungesichert durchgeführt wurden. [NBC26]
Bei Apocalypse Now (1979) griff Regisseur Francis Ford Coppola für eine Schlüsselszene auf die reale Schlachtung eines Wasserbüffels zurück, die von einem indigenen Stamm tatsächlich durchgeführt wurde. Die Szene wurde ungeschnitten in den Film übernommen und gehört bis heute zu den umstrittensten Momenten des New-Hollywood-Kinos. [Slashfilm]
Trotz dieser dokumentierten Grausamkeiten gilt keiner dieser Filme als Snuff. Sie wurden von Kritikern gefeiert, mit Oscars ausgezeichnet und gehören längst zum Kanon der Filmgeschichte. Das zeigt, wie sehr sich die Debatte um Snuff auf den Mythos menschlicher Tötungen vor laufender Kamera konzentriert, während reale Tieropfer im Mainstreamkino über Jahrzehnte kaum hinterfragt wurden.
Ein weiteres Beispiel ist Faces of Death (1978), ein sogenannter Mondo-Film, der dokumentarisches Material mit inszenierten Szenen mischte. Laut dem Film wurde er präsentiert wie eine Doku, doch hinter vielen Bildern verbargen sich Effekte oder gekaufte Archivaufnahmen. Umgekehrt stammen etwa 60 Prozent des Materials aus echten Nachrichtensendungen, Autopsien, Unfällen oder Katastrophen. Der Rest wurde nachgestellt. Viele Zuschauer waren verunsichert und glaubten, echte Tötungen könnten Teil des Films sein. [iHorror, Bloody Disgusting]
Diese Mischung zeigt: Auch ohne echten Snuff konnte die blutige Ästhetik und angebliche Echtheit solcher Filme den Mythos von realer Gewalt im Medium Film verstärken.
Regisseure am Rand der Realität: Provokation oder Snuff-Film Mythos?
Valentine Lucifer (bürgerlich Shawn Fedorchuck) zählt zu den Regisseuren, die bewusst mit dem Snuff-Image spielen, ohne es einzulösen. Mit seiner Vomit Gore Trilogy (Slaughtered Vomit Dolls, ReGOREgitated Sacrifice, Slow Torture Puke Chamber) prägte er das Subgenre, das er selbst «Vomit Gore» nannte. Grundlage dieser Filme ist seine Emetophilie (sexuelle Erregung durch Erbrechen), die er offen thematisierte. Deshalb ist das Erbrechen in den Filmen echt, während die Tötungen inszeniert bleiben. [Underground Horror]
Seine Werke gelten in der Szene als extrem, doch inhaltlich sind sie kaum mehr als Gewaltpornos und bieten keinen nennenswerten Mehrwert. Genau diese Mischung aus echtem Ekel und inszenierter Gewalt sorgt bei einem kleinen Kreis von Extremhorror-Fans für Faszination, während der breite Rest der Szene eher mit Ablehnung reagiert. Weil Valentine mit dieser radikalen Form so stark provoziert, haften seinen Filmen Snuff-Assoziationen besonders hartnäckig an, auch wenn sie ihn faktisch nie einlösen.
Einen Einblick in seine Arbeitsweise bietet ein Interview auf Punkglobe. In Deutschland ist die gesamte Vomit Gore Trilogy seit 2018 nach § 131 StGB beschlagnahmt und damit verboten (Wikipedia DE).
Ein weiterer Name, der im Umfeld des Snuff-Mythos immer wieder fällt, ist Marian Dora. Seine Filme wie Melancholie der Engel oder Cannibal sind inhaltlich ähnlich extrem, verbinden explizite Gewalt mit Sexualität und gelten selbst unter Horrorfans als schwer verdaulich. Auch hier überwiegt der Eindruck von Gewaltpornografie, die wenig mehrwertige Substanz bietet. Wie schon bei Valentine sorgt genau diese Grenzüberschreitung für die anhaltende Nähe zum Snuff-Image. [Severed Cinema]
Auch Fred Vogel bewegt sich mit seiner Reihe August Underground in einem ähnlichen Spektrum. Die Filme sind als Pseudo-Snuff inszeniert und wirken durch ihre rohe Ästhetik wie echte Homevideos von Mördern. Filmisch bleibt auch hier wenig hängen, ausser dem Anspruch, möglichst extreme Reaktionen beim Publikum hervorzurufen.
Ferner gäbe es noch weitere Regisseure, die in diesem extremen Spektrum arbeiten. Für diesen Artikel reicht es jedoch, die drei Elefanten im Raum zu nennen. Weitere möchte ich hier nicht pushen, weil ihre Werke ausschliesslich der Provokation dienen und weder filmisches Können noch ein ernsthaftes Drehbuch erkennen lassen.
Diese extremen Werke spielen zwar mit dem Mythos Snuff, aber sie sind es eben doch nicht. Und gerade weil selbst Filme, die nur in kleinen Kreisen zirkulieren und bewusst jede Grenze austesten, diesen Tatbestand nicht erfüllen, wird deutlich, wie schwierig es sein müsste, einen echten Snuff-Film zu produzieren und vor allem zu vermarkten.
Psychischer Snuff: Wenn das Opfer lebt, aber zerbricht
Snuff muss nicht zwingend den Tod zeigen. Auch psychische Zerstörung kann vor laufender Kamera stattfinden und in ein Werk eingehen.
Ein bekanntes Beispiel ist The Shining (1980). Schauspielerin Shelley Duvall wurde von Regisseur Stanley Kubrick über Monate hinweg unter enormen Druck gesetzt. Über hundert Takes, Isolation und ständige Manipulation führten bei ihr zu Nervenzusammenbrüchen [People, Far Out Magazine, Business Insider].
Maria Schneider bei Der letzte Tango in Paris (1972):
Die berühmte Vergewaltigungsszene, bei der Butter als Gleitmittel benutzt wurde, war nicht im ursprünglichen Drehbuch vorgesehen. Schneider wurde kurz vor Drehbeginn darüber informiert, was sie als «innere Erniedrigung» und «real empfundene Vergewaltigung» beschrieb [PBS, The Guardian, Business Insider].
Linda Blair bei Der Exorzist (1973):
Blair erlitt bei einer Szene, in der sie auf einer mechanischen Pritsche wütend umherwirbelte, eine Wirbelfraktur. Später entwickelte sich daraus Skoliose und chronische Schmerzen. [SyFy]
Tippi Hedren bei Die Vögel (1963):
Hitchcock setzte sie echten Vögeln aus, obwohl sie über mechanische Vögel informiert worden war. Die Tiere griffen sie an: Laut eigener Aussage wurde sie über Tage hinweg zu lang genommenen Szenen mit echten Angriffen gezwungen. [People, Business Insider]
Diese Beispiele zeigen: Snuff im engeren Sinn mag Fiktion bleiben.
Doch Snuff im weiteren Sinn, das bewusste Ausnutzen und Brechen von Menschen für ein filmisches Resultat, existiert.
Moralpanik, Religion und die Lust der Medien am Snuff-Film Mythos
Kaum ein Thema im Grenzbereich von Kino, Gewalt und paranoiden Vorstellungen hat so stark religiöse Stimmen und mediale Panik hervorgerufen wie die Legende vom Snuff-Film. In den 1980er-Jahren warnten insbesondere evangelikale Gruppen in den USA im Rahmen der sogenannten Satanic Panic vor satanistischen Zirkelringen, die Kinder missbrauchten, Menschen opferten und solche Taten filmten. Solches vermeintliches Material diente als Beweis für geheime Verbrechen und befeuerte indirekt die Snuff-Mythologie. [Lydia Benecke]
Boulevardmedien in Grossbritannien
In Grossbritannien verstärkten Boulevardmedien wie Daily Mail und The Sun die Video‑Nasties-Debatte über explizite Horrorvideos, die als moralisch gefährlich diffamiert und teils verboten wurden. Medien wie die Daily Mail veröffentlichten Schlagzeilen wie «Ban video sadism now» und «Rape of our children’s minds», um Panik zu schüren. Diese Berichterstattung beeinflusste die öffentliche Stimmung und ebnete den Weg zur Gesetzesreform, insbesondere dem Video Recordings Act von 1984, der erstmals eine verpflichtende Klassifizierung von Videofilmen einführte. [Independent, The Guardian, Open Edition]
Alte Geschichten, neu aufgelegt
Heute erfahren diese Strukturen durch Bewegungen wie QAnon eine digitale Wiedergeburt. Der Mechanismus bleibt derselbe: geheime Eliten, Kinderopfer und angebliche Beweisvideos werden heraufbeschworen, um Angst zu erzeugen und das Narrativ weiterzuspinnen.
Diese Form der Panik beruht auf alten Verschwörungssträngen, insbesondere der Ritualmordlegende gegen Jüdinnen und Juden im Mittelalter. Die Satanic Panic war eine moderne Auffassung dieser antisemitischen Projektionen. Heute erscheinen sie verpackt in neuen Mythen wie der satanistischen Elite bei QAnon. [University of Memphis]
Es entstand ein Teufelskreis: Religiöse Akteure warnten vor einem heimlichen Bösen, die Medien machten daraus Sensation, und das Publikum fühlte sich in seiner Angst bestätigt. Statt Mythen zu hinterfragen, wurden sie durch mediale Verwertung stets weitergetragen. Bis heute tauchen Snuff-Gerüchte in Artikeln, Talkshows und Foren auf, obwohl bislang kein echter, marktreifer Snuff-Film aufgetaucht ist. [Fangoria]
Realität statt Mythos: Gewalt vor der Kamera
Ich möchte betonen, dass folgende Beispiele nicht die Regel auf diesen Plattformen sind. Doch gerade durch ihren verstörenden Charakter können solche Aufnahmen traumatisierend wirken und schlimmstenfalls zu Nachahmungstaten anstiften.
Die bittere Wahrheit lautet: Der Snuff-Mythos hat sich im digitalen Raum ins Reale manifestiert. Plattformen, die ursprünglich für Let’s Plays, Reactions, Comedy und viele andere Formen von Unterhaltung gedacht waren, wurden unfreiwillig zu Kanälen des Grauens. Diese Inhalte sind in ihrer Wirkung verstörender, weil sie nicht gestellt sind und echte Menschenleben zeigen, welche durch Fanatismus beendet werden. Was dem Snuff-Mythos nie gelang, erreicht durch reale Streams abertausende Menschen, welche das Gesehene teilen und kommentieren.
Von Christchurch bis Halle
Ein prominentes Beispiel ist das Attentat von Christchurch 2019. Der Täter übertrug sein Massaker an zwei Moscheen live auf Facebook [BBC]. Auch beim Anschlag in Halle 2019 filmte sich der Täter mit einer Helmkamera, während er versuchte, in eine Synagoge einzudringen und dabei mehrere Menschen tötete [mdr]. Und der sogenannte Islamische Staat nutzte über Jahre hinweg Hinrichtungsvideos als Propagandamaterial, die weltweit verbreitet wurden [Nature].
Darüber hinaus gibt es Fälle, die filmische Mittel nutzen, um echte Gewalt in Szene zu setzen. 2012 veröffentlichte Luka Magnotta das Video 1 Lunatic 1 Ice Pick, in dem er den Studenten Jun Lin nach dessen Tod zerstückelte und schändete. Der eigentliche Mord ist nicht zu sehen, doch das Video war wie ein Film geschnitten, mit Musik und einer Titeltafel. Erst als Magnotta Körperteile an Politiker verschickte, wurde klar, dass es sich um ein reales Verbrechen handelte. Er wurde schliesslich in Deutschland verhaftet und in Kanada zu lebenslanger Haft verurteilt. [Spiegel, BBC]
Auch andere Täter bedienten sich filmischer Techniken. 2007 filmten zwei Jugendliche in der Ukraine, bekannt als die Dnepropetrowsk Maniacs, einen Mord mit dem Handy und stellten das Video ins Netz. Diese Tat erlangte weltweite Aufmerksamkeit und gilt bis heute als eines der grausamsten Beispiele für reale Gewalt im Internet. [The Guardian]
Warum dieser Text
Ich habe diesen Artikel schon länger in der Schublade. Doch als ich vor Kurzem einen politischen Stream sah, in dem ein durchaus aufgeklärter Streamer, der sich selbst als Horrorfilm-Fan bezeichnet, behauptete, es gäbe echte Snuff-Filme, horchte ich auf. Da wurde mir klar, dass diese düstere Legende noch immer lebt. Es scheint auch in aufgeklärt linken Bubbles nicht ungewöhnlich, dieses Verschwörungsnarrativ zu verbreiten. Gerade deshalb war es mir ein Anliegen, diesem Mythos einmal den Stecker zu ziehen.
Fazit: Der Snuff-Film Mythos und die reale Gefahr
Der Snuff-Mythos entstand literarisch mit Ed Sanders, wurde durch die Findlays’ Slaughter und Shackletons Neuveröffentlichung als Snuff in die Popkultur getragen, wuchs in der VHS-Kultur, wurde durch staatliche Zensur befeuert und durch Grenzregisseure im Exploitation-Kino am Leben gehalten. Selbst Werke von Lucifer Valentine, Marian Dora oder Fred Vogel, die bewusst jede Grenze austesten und nur in kleinen Kreisen zirkulieren, erfüllen den Tatbestand nicht. Genau das zeigt, wie schwer es wäre, einen echten Snuff-Film nicht nur zu produzieren, sondern auch zu vermarkten.
Doch echte Snuff-Filme, die gezielt für den Markt produziert werden, gibt es nicht. Die wirkliche Gefahr liegt heute in Livestreams von Gewalt, digitale Terrorvideos und einer Infrastruktur, die reale Gewalt jederzeit sichtbar macht. Der Mythos bleibt Fiktion, während der reale Horror längst in Echtzeit streamt.
Man benötigt also keine Legenden, um den Schrecken zu finden. Er ist längst da und für jeden sichtbar, der ihn sehen will. Vielleicht dient der Snuff-Mythos manchen Menschen als Ventil, um ihr Weltbild stabil zu halten und bestehende Verschwörungserzählungen mit einem weiteren Puzzleteil zu ergänzen. Diese Muster reichen von politischen Extremen bis zu religiösem Fanatismus. Damit verschiebt sich der Fokus weg von dokumentierter realer Gewalt, die in Videos und Streams nachweisbar existiert, hin zu imaginären Erzählungen über geheime Eliten, die angeblich im Hintergrund wirken.