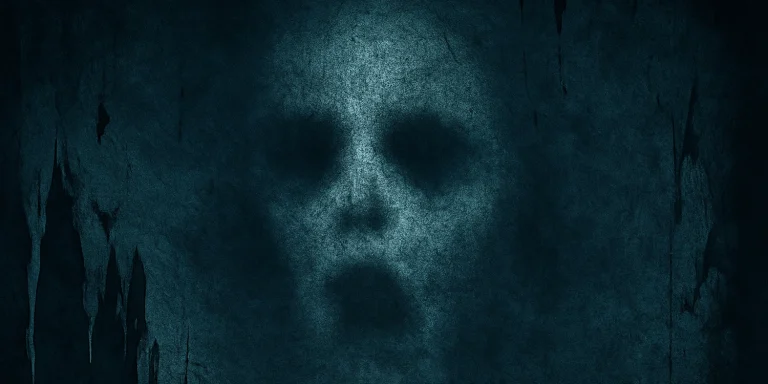Wie Glaube Angst erschafft
Einleitung der Reihe
Unter Luzifers Schwingen beginnt keine Anbetung, sondern eine Beobachtung. Diese Essays werden in drei Teilen zeigen, wie Religion, Kino und Gesellschaft das Böse formen, um Ordnung zu erzeugen. Luzifer steht hier nicht als Dämon, sondern als Symbol für Erkenntnis, für das Denken jenseits von Gehorsam und Angst. Seine Schwingen gleiten über Filme, Mythen und moralische Systeme, die alle denselben Ursprung teilen: den Versuch, das Unbegreifliche zu erklären. Der Teufel wird so zur Chiffre einer kollektiven Furcht, die weniger über ihn erzählt als über jene, die ihn benötigen.
Diese Angst nahm zuerst Gestalt in der Religion an, lange bevor das Kino sie für sich entdeckte.
Dieser Text ist eine nüchterne Betrachtung aus der Sicht eines Rationalisten, der keinen Platz für den Glauben an übernatürliche Wesen oder göttliche Erzählungen hat. Es schmälert die Wirkung der erwähnten Filme nicht, sondern zeigt, aus welcher Perspektive ich sie betrachte. Ich sehe sie nicht durch den Glauben, sondern durch eine kritische Distanz. Vielleicht erklärt das, weshalb mich manche dieser Werke weniger unterhalten, sondern vielmehr zum Nachdenken über die Intention ihrer Macher:innen anregen.
Der Spiegel der Moral
Satanismus ist kein Gegen-Glaube, sondern ein Spiegel. Seine Existenz verdankt er dem Christentum, das ihn geschaffen hat, um sich selbst zu definieren. Wer am lautesten vor Luzifer warnt, glaubt meist am innigsten an ihn. Erst das Christentum formte aus einem poetischen Bild des Morgensterns den gefallenen Engel, den es zum Symbol des Bösen erklärte. In diesem Sinn sind die wahren Satanist:innen die Christ:innen, die ihn täglich beschwören, während jene, die sich als Satanist:innen bezeichnen, vorwiegend eine Philosophie vertreten: frei von Dogma, frei von Göttern, aber mit Bewusstsein für Symbolik.
Ich möchte mich diesem Thema nur oberflächlich nähern. Nicht als Religionsforscher, sondern als Beobachter. Zwar beschäftige ich mich seit Jahrzehnten mit Religionen, habe jedoch nie Theologie oder Philosophie studiert. Mein Ziel ist, den Blick auf das zu lenken, was Filme und Gesellschaft wirklich zeigen, wenn sie über Satanismus sprechen, vorwiegend über ihre eigenen Ängste davor.
Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, findet am Ende jedes Abschnitts ausgewählte Quellen und weiterführende Texte. Dieser Artikel will kein Glaubenssystem erklären, sondern die Wahrnehmung beleuchten, die daraus gemacht wurde. Noch bevor Hollywood den Teufel zum Kassenschlager machte, existierte er als Projektion. Als Spiegelbild des Unverstandenen, als Sammelbecken für Schuld, Begierde und Macht. Und bis heute erzählen viele Filme über Satanismus weniger über das Böse als über jene, die es sehen wollen.
Satan als Spiegel der Angst
In vielen europäischen Autor:innenfilmen taucht Satan nicht als Wesen auf, sondern als inneres Echo. Er entsteht im Kopf der Gläubigen, in der Stille der Landschaft, in der Einsamkeit der Seele. Diese Filme handeln nicht von Teufelsanbetung, sondern vom Wahn, der entsteht, wenn Glaube sich in Furcht verwandelt.
In Hagazussa von Lukas Feigelfeld wird die Hexenangst zur Selbstverwirklichung des Dorfes. Die junge Frau Albrun wird von ihrer Umgebung gemieden, gefürchtet und schliesslich verachtet. Der Satan, den die Dorfbewohner:innen bekämpfen, existiert nur in ihren Köpfen. Albrun selbst bleibt passiv, doch die kollektive Angst macht sie zur Projektionsfläche. Sie wird das, was man in ihr zu sehen glaubt.
Mehr zum österreichischen Genrekino findest du in meinem Artikel Sachertorte mit Rasierklingen
In Akelarre von Pablo Agüero ist es nicht der Glaube der Frauen, sondern die Macht der Kirche, die den Teufel heraufbeschwört. Die Hexenprozesse sind ein theatralischer Akt der Kontrolle, eine religiöse Inszenierung, in der Satan als politisches Werkzeug dient. Die angeblichen Hexen wissen, dass der Teufel nur in den Vorstellungen der Männer existiert, und beginnen, diese Vorstellung gegen sie zu verwenden.
Luzifer von Peter Brunner führt diese Logik weiter. Eine Mutter, gefangen in religiöser Angst, versucht ihren Sohn vor dem Bösen zu schützen, das sie selbst erschafft. Ihr Glaube wird zum Wahn, ihre Fürsorge zur Folter. Der Teufel ist nicht in der Natur, sondern im Glauben, der sie vergiftet.
In Requiem von Hans-Christian Schmid wird dieser Wahn ganz entkleidet. Keine Dämonen, keine Spezialeffekte, nur Krankheit und Schuld. Eine junge Frau zerbricht zwischen Religion, Psychose und familiärem Druck. Der Exorzismus, den sie erfährt, heilt nichts, sondern bestätigt nur die Angst derer, die sie behandeln.
Und schliesslich The Witch of Kings Cross, eine Dokumentation über die australische Künstlerin Rosaleen Norton. Ihre erotischen, mythologischen Werke machten sie in den fünfziger Jahren zur Zielscheibe kirchlicher und staatlicher Repression. Satanismus wurde ihr Etikett, nicht ihr Inhalt. Was sie suchte, war Ausdruck, nicht Anbetung.
Diese Filme teilen denselben Ursprung: den religiösen Reflex, das Unbegreifliche als dämonisch zu bezeichnen. Satan steht hier nicht für das Böse, sondern für Freiheit, Körper, Selbstbestimmung, Sexualität und Wissen. Alles, was sich der Kontrolle entzieht, wird zur Versuchung erklärt.
Der Körper als Sakrileg
Wenn der Teufel in diesen Filmen auftaucht, dann oft durch den Körper. Nicht als Gestalt, sondern als Sinnlichkeit, als Instinkt, als Ausdruck. In patriarchalen Glaubenssystemen wurde der Körper seit Jahrhunderten zum Träger der Schuld. In der christlichen Symbolik galt er stets als Tor, das den Weg zu Sünde und Versuchung öffnet.
Filme wie Hagazussa und Akelarre greifen genau diesen Mechanismus auf. Die Frau, die sich dem religiösen Gehorsam entzieht, wird nicht bestraft, weil sie sündigt, sondern weil sie sich erinnert, dass sie ein Körper ist. Sexualität, Lust, Blut und Geburt werden dämonisiert, weil sie an die Natur erinnern, nicht an Gott.
In The Witch of Kings Cross wird dieser Konflikt sichtbar. Rosaleen Norton malte ihre eigene Spiritualität, in der Körper und Mythos ineinander übergingen. Dafür wurde sie kriminalisiert und zensiert, ihre Kunst galt als zu sinnlich, zu direkt und zu frei. Doch sie zeigte, dass der weibliche Körper nicht sündig ist, sondern heilig, wenn er sich selbst gehört.
Der sogenannte satanische Blick in solchen Filmen ist in Wahrheit ein Gegenblick. Er richtet sich nicht nach oben, sondern nach innen. Er fragt, warum religiöse Systeme das Menschliche so lange bekämpft haben, bis es sich selbst zum Feind wurde.
Satan als Symbol der Erkenntnis
Im Kern steht immer dieselbe Bewegung. Wer den Teufel sieht, sieht sich selbst.
Satan ist in diesen Filmen kein Dämon, sondern ein Spiegel. Er steht für Erkenntnis, nicht für Versuchung. Er erinnert daran, dass jede moralische Ordnung auf Angst gebaut ist, und Befreiung nur möglich wird, wenn man diese Angst verliert.
Die Regisseur:innen, die sich diesem Thema nähern, tun das meist ohne Effekte, oder religiöse Pose. Sie benutzen Satan nicht als Feindbild, sondern als Metapher für das Erwachen. Das gilt für Luzifer ebenso wie für Hagazussa. Beide Filme zeigen Figuren, die durch Isolation und Glauben gebrochen werden und darin etwas anderes erkennen: dass das Böse eine menschliche Konstruktion ist.
Diese Form des Kinos ist kein Angriff auf Religion, sondern ein Akt der Selbstklärung. Es zeigt, wie leicht Angst zur Theologie wird und wie schwer es ist, sich davon zu lösen.
Abschluss von Teil 1: Die Erfindung des Bösen
Satan ist keine Figur der Rebellion, sondern der Deutung. Er entsteht dort, wo Menschen das Unverfügbare fürchten. In den europäischen Filmen, die sich mit diesem Thema befassen, ist er kein Feind, sondern ein Gedanke. Ein Gedanke, der sich aus Angst gebiert und in Angst erhalten bleibt.
Die Dorfbewohner:innen in Hagazussa, die Inquisitor:innen in Akelarre und die Mutter in Luzifer erschaffen ihren eigenen Teufel. Sie erschaffen ihn, weil sie ihn benötigen. Ohne das Böse gäbe es keine Ordnung, ohne Schuld keinen Glauben. Die Angst ist das Fundament der Moral, und der Teufel ihr sichtbarer Ausdruck.
Doch wo diese Angst sich auflöst, verliert die Religion ihre Macht. Die Filme dieses ersten Kapitels zeigen keine Magie und keinen Glauben an übernatürliche Kräfte. Sie zeigen, wie Religion das Böse erfindet, um sich selbst zu rechtfertigen.
Bevor Hollywood diese Angst industrialisierte, bevor sie zu Franchises, Sequels und moralischen Warnmärchen wurde, existierte sie als stilles Zittern im Kopf der Gläubigen. Ein Zucken zwischen Schuld und Sehnsucht.
Dort endet die symbolische Ebene des Teufels und beginnt sein Verkauf.
Überleitung zu Teil II: Hollywoods Dämonenmaschine
Die Kirche war das erste Hollywood. Sie machte aus Angst eine Währung und aus Erlösung ein Monopol. Luzifer wurde ihr wirksamstes Symbol, ein Name, der Kontrolle versprach und Gehorsam erzwingt. Wer sich fürchtet, sucht Schutz, und wer Schutz sucht, zahlt mit Glauben und Geld. Diese Logik blieb bestehen, auch als die Leinwand den Altar ablöste. Hollywood übernahm die Methode, nicht die Moral. Es tauschte das Kreuz gegen Zelluloid und entdeckte, dass sich die Angst vor dem vermeintlich Bösen noch immer gut verkaufen lässt.
Quellen
- Sachertorte mit Rasierklingen (Mein Artikel über das österreichische Genrekino)
- They were talked about… and they were out there. Witchcraft in the Pyrenees and western districts
- Stereotypes about the inquisitorial persecution of witchcraft
- Contemporary Religious Satanism (Buch)
- The Encyclopedic Sourcebook of Satanism (Buch)
- Church of Satan
- Nick Allens Review über Hagazussa
- ‘Akelarre’: San Sebastian Review
- Akelarre (Coven of Sisters): the real story behind the hit new movie, now on Netflix
- Church of Satan: eine Kirche der Teufelsanbeter?
- Church of Satan (CoS) auf relinfo
- The Satanic Temple