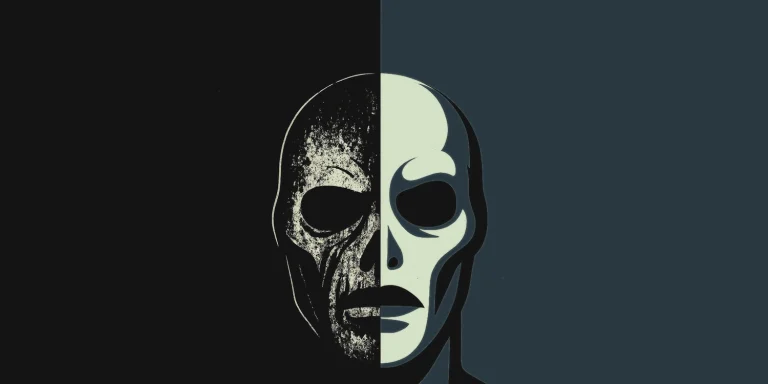Hollywoods Dämonenmaschine: Vom Glauben zum Spektakel
Einleitung
Unter Luzifers Schwingen gleitet der Blick von den stillen europäischen Bergen in die Kulissen von Hollywoods Dämonenmaschine. Das Kino hat den Teufel nicht erfunden, sondern ihn dankbar übernommen. Es machte aus der alten religiösen Angst ein Bild, das sich verkaufen lässt, und aus dem Glauben ein Spektakel. Die Leinwand ersetzte den Altar, doch das Ritual blieb dasselbe: Busse, Versuchung, Erlösung, Wiederholung.
Dieser Text ist eine nüchterne Betrachtung aus der Sicht eines Rationalisten, der keinen Platz für den Glauben an übernatürliche Wesen oder göttliche Erzählungen hat. Es schmälert die Wirkung der erwähnten Filme nicht, sondern zeigt, aus welcher Perspektive ich sie betrachte. Ich sehe sie nicht durch den Glauben, sondern durch die Distanz. Vielleicht erklärt das, weshalb mich manche dieser Werke weniger unterhalten, sondern vielmehr zum Nachdenken über die Intention ihrer Macher anregen.
Das Kino der Erbsünde
Ich erinnere mich, dass mein erster Kontakt mit filmischem Satanismus Race with the Devil war. Ich war noch ein Kind und verstand kaum, was ich sah, aber die Bilder blieben: nächtliche Rituale, maskierte Gestalten, ein Gefühl von Bedrohung, das ebenso faszinierte wie es erschreckte. Hollywood verkaufte mir nicht den Teufel, sondern die Urangst vor ihm. Dieses Produkt löste bei mir keinen Glauben aus, sondern Neugier. Vielleicht begann dort meine Faszination für das, was Menschen fürchten und was sie brauchen, um sich davor zu retten.
Rosemary’s Baby von Roman Polanski (1968) gab dem Satanismus eine psychologische Form. Eine junge Frau wird schwanger und von allen Seiten manipuliert, bis sie erkennt, dass sie den Sohn des Teufels trägt. Der Film bleibt ambivalent. Er kann als Paranoia einer isolierten Frau gelesen werden oder als reale satanische Verschwörung. Hollywood und die Medien entschieden sich für Letzteres. Was ursprünglich ein Film über weibliche Angst, Körperkontrolle und patriarchale Manipulation war, wurde in der Rezeption zum Teufelsdrama. Damit begann die kommerzielle Geburt des modernen Satanismus im Kino, nicht als Glaube, sondern als Narrativ, das sich perfekt vermarkten liess.
The Exorcist von William Friedkin (1973) brachte den Teufel dann endgültig in die Wohnzimmer. Die Besessenheit des Mädchens Regan wurde zum globalen Schockbild, zur Massenoffenbarung. Der Film lebt von der Spannung zwischen medizinischer Erklärung und religiösem Wahn, doch am Ende siegt der Glaube. Friedkin machte die Angst wieder sakral und stellte den Priester als letzten Retter einer zerrissenen Moderne dar. The Exorcist ist kein Film über Satan, sondern über das Bedürfnis nach Erlösung.
Das Mädchen wird nicht vom Teufel heimgesucht, sondern von der Unfähigkeit einer Gesellschaft, ohne das Böse auszukommen. Regisseur William Friedkin verstand das instinktiv: Sein Pazuzu ist kein dämonisches Wesen, sondern ein Spiegel. Er zeigt, dass selbst ein uralter mesopotamischer Dämon erst durch christliche Symbolik Bedeutung bekommt. Ohne Kreuz kein Exorzismus, ohne Glaube kein Teufel.
The Omen von Richard Donner (1976) führte das Konzept weiter. Der Antichrist wächst in einer bürgerlichen Familie auf, und das Böse wird zur genealogischen Katastrophe. Die Geschichte reproduziert biblische Furcht, als wäre sie moderne Mythologie. Der Teufel wird nicht verstanden, sondern erklärt. Und was erklärt ist, kann verkauft werden.
Gerade hier zeigt sich Hollywoods Unvermögen, das Böse als Intelligenz zu begreifen. The Omen beginnt mit einer faszinierenden Idee, dass das Böse als Mensch unter Menschen lebt, und biegt dann falsch ab. Statt Manipulation, Versuchung oder psychologischem Einfluss zeigt der Film spektakuläre Todesfälle. Das Böse agiert wie eine Naturgewalt, nicht wie Bewusstsein. Es wirkt, als sei Luzifer nicht mächtig genug, um Menschen zu verführen, also lässt er sie einfach sterben. Der Film verliert dadurch seine eigentliche Stärke: die Möglichkeit, das Böse als soziale oder geistige Macht zu zeigen.
Angel Heart von Alan Parker (1987) verlagert das Dämonische in die Psyche. Der Teufel tritt hier nicht als Widersacher Gottes auf, sondern als Vollstrecker menschlicher Schuld. Die Grenze zwischen Täter und Opfer verschwimmt, und das Böse zeigt sich als Konsequenz verdrängter Wahrheit. Für mich ist es der beste Luzifer-Film überhaupt, auch wenn er stellenweise etwas holprig daherkommt. Er macht aus Luzifer das, was man aus der Bibel kennt: einen Verführer, der keine Gewalt braucht, weil er nur die Richtung zeigt. Den Weg gehen die Menschen selbst.
The Devil’s Advocate von Taylor Hackford (1997) dagegen macht aus Luzifer den charmanten Anwalt, der die Welt mit Logik und Versuchung verführt. Al Pacino verkörpert den Teufel als Manager der modernen Eitelkeit, als Chefjuristen der menschlichen Selbstrechtfertigung. Der Film enthüllt das Böse als verführerische Rationalität, nicht als Mythos. In seiner grossen Rede feuert Luzifer eine verbale Salve gegen Gott ab und stellt ihn als selbstgefälligen, untätigen Tyrannen dar. Gott erscheint ohnmächtig, Luzifer dagegen lebendig und menschlich. Diese Szene ist pure Verführung, ein Triumph der Intelligenz über Gehorsam.
Lucifer (TV-Serie, 2016–2021) führt diese Entwicklung ins Absurde. Aus dem gefallenen Engel wird ein gutaussehender Privatdetektiv im Massanzug, der Verbrechen löst und Selbstzweifel mit Charme überspielt. Der Luzifer dieser Serie ist kein Symbol mehr, sondern ein Unterhaltungsprodukt. Er spiegelt das Ende eines Hollywoods, das einst Mythen erschuf und heute nur noch deren Hüllen recycelt. In ihm zeigt sich der Zustand des amerikanischen Kapitalismus, der wie ein untoter Körper weiterläuft, während das Denken längst erloschen ist. Luzifer ist nicht mehr der Widersacher, sondern der Therapeut einer müden Kultur.
Weitere erwähnenswerte Filme
The Black Cat (1934), Night of the Demon (1957), The Brotherhood of Satan (1971), The Antichrist (1974), To the Devil a Daughter (1976), Alucarda (1977), The Sentinel (1977), Prince of Darkness (1987), Hellraiser (1987), Stigmata (1999), End of Days (1999), The House of the Devil (2009), Baskin (2015), Errementari: The Blacksmith and the Devil (2017), Antrum (2018), Hereditary (2018), Anything for Jackson (2020), Hellhole (2022), When Evil Lurks (2023).
Das Böse als Marke
In den neunziger Jahren trat der Teufel endgültig aus der Theologie heraus und in die Erzählstruktur des Kinos ein. The Devil’s Advocate machte ihn zum charmanten Anwalt, zur Personifikation eines Systems, das Moral nur als Fassade kennt. Angel Heart, wenige Jahre zuvor, hatte ihn bereits als melancholischen Verführer gezeigt, der Schuld nicht straft, sondern erkennt. Beide Werke entkleiden das Böse seiner metaphysischen Dimension und verlagern es in den menschlichen Willen. Der Teufel ist nun keine Gestalt mehr, sondern eine Möglichkeit.
Mit The Ninth Gate (1999) fand dieses Motiv seine wohl raffinierteste Form. Roman Polanski machte aus dem Teufel keine Figur, sondern eine Idee. Er ist die Versuchung des Wissens, die Verführung durch Erkenntnis selbst. Der Film zeigt, dass das Böse nicht durch Glauben entsteht, sondern durch Neugier, durch die Lust, hinter den Vorhang zu blicken. Polanski entzieht dem Satanischen jede Moral und verwandelt es in eine intellektuelle Bewegung, in das unaufhörliche Streben nach verbotener Wahrheit.
Hollywood perfektionierte damit, was die Kirche begonnen hatte: die industrielle Wiederholung der Angst. Jeder Film verkauft denselben Mechanismus der Beruhigung. Das Böse bleibt fassbar, kontrollierbar und konsumierbar. Glauben und Unterhaltung verschmelzen zu einem System, das dieselbe Struktur hat wie eine Messe, nur ohne Altar. Man schaut, man zittert, man wird erlöst. Und am Ende flackert der Abspann wie ein Amen über der Dunkelheit.
Zwischen Realität und Inszenierung
In der realen Welt wurde der Glaube längst säkularisiert, doch die Mechanik der Angst blieb erhalten. The Most Hated Woman in America (2017) erzählt die Geschichte von Madalyn Murray O’Hair, einer Atheistin, die in den Vereinigten Staaten das Recht auf Glaubensfreiheit auch für Nichtgläubige erstritt. Ihre Weigerung, sich religiösem Druck zu beugen, machte sie zur Zielscheibe einer ganzen Nation. Medien und Kirchen stilisierten sie zur Bedrohung, zur gottlosen Feindin im eigenen Land.
Bemerkenswert ist, dass O’Hair schliesslich selbst eine Art Gegenkirche gründete, die American Atheists. Damit schuf sie eine Struktur, die in Organisation und Auftreten jenen religiösen Institutionen ähnelte, gegen die sie ursprünglich angetreten war. Gerade darin liegt ein Widerspruch, der den amerikanischen Atheismus einzigartig macht. Der Glaubensgedanke verschwindet nicht, er verwandelt sich. Der Kampf gegen Religion wird selbst zu einer Art Glaubenssystem, das Führungsfiguren, Dogmen und Anhänger kennt.
O’Hair wurde damit zu einer Figur, die in keinem Horrorfilm auftreten müsste, um Angst zu erzeugen. Ihre Existenz genügte. Der Film zeigt, wie Religion und Öffentlichkeit Hand in Hand arbeiten, um ein Gesicht für das Böse zu finden, wenn kein Dämon zur Verfügung steht. Wo früher die Kirche den Scheiterhaufen entzündete, reichen heute Kamera, Empörung und ein geschickt inszeniertes Feindbild. Der Teufel ist austauschbar, solange er sich verkauft.
Wer sich allerdings wirklich für O’Hairs Geschichte interessiert, sollte eher zur Dokumentation Godless in America greifen. Der Netflix-Film bleibt in manchen Punkten unklar und lässt zentrale Aspekte ihres Wirkens, etwa ihre institutionelle Rolle innerhalb der American Atheists, nur erahnen. Godless in America vermittelt das Spannungsfeld zwischen Überzeugung, Macht und öffentlicher Wahrnehmung sehr viel präziser.
Der Grenzfall: The VVitch
Doch während Hollywood den Teufel zur Massenware machte, entstanden Filme, die seine Ikonografie still zersetzten. The VVitch von Robert Eggers kehrt an die Wurzeln der religiösen Paranoia zurück, an die Grenze zwischen Glauben und Wahn. Er zeigt, wie die Vorstellung des Bösen eine Familie zerstört, ohne dass es je erscheint. Der Teufel existiert nur durch das, was die Menschen in ihm sehen. Damit schliesst sich der Kreis zu Hagazussa und Akelarre. Zwischen europäischer Askese und amerikanischem Spektakel liegt die eigentliche Frage: ob das Böse überhaupt ohne Zuschauer existieren kann.
Meiner Meinung nach beginnt The VVitch stark, mit einer rohen Atmosphäre und einem klaren Blick auf religiösen Wahn. Doch gegen Ende verliert der Film diesen Fokus und flüchtet sich in das, was er zu Beginn kritisiert: die Vorstellung realer dämonischer Kräfte. Er beginnt als Studie über Angst und endet als Bekenntnis zu ihr. Das ist bedauerlich, weil Eggers genau dort, wo er sich vom Übernatürlichen hätte lösen können, wieder in dessen Arme fällt. Eine Entwicklung wie in Hagazussa oder The Devil’s Bath hätte ich hier deutlich stärker gefunden. Beide Filme zeigen, dass das Grauen oft aus der Welt selbst kommt Aus der Isolation, dem Aberglauben und psychischer Zerrüttung, nicht aus einem metaphysischen Bösen. The VVitch dagegen bestätigt am Ende den christlichen Mythos, anstatt ihn zu dekonstruieren.
Abschluss Teil 2: Der Teufel im Vertrieb
Was Hollywood verkauft, ist nicht der Teufel, sondern die Beruhigung, dass es ihn angeblich gibt. Angst wird zum Produkt, Moral zum Design. In den grossen Studios lebt der alte Glaube fort, nur effizienter. Der Zuschauer bezahlt für dieselbe Erlösung, die die Kirche einst versprach, nur verpackt in zwei Stunden Dunkelheit und Popcorn.
Die Leinwand ersetzt die Kanzel, der Projektor das Licht aus der Höhe. Zwischen Predigt und Projektion liegt kein Unterschied, nur ein Ticketpreis. Wer in diesen Filmen den Teufel sucht, findet nur die Angst, die ihn erschaffen hat.
Doch diese Angst dient einem bestimmten Publikum. Sie soll vor allem jene abholen, die ohnehin glauben wollen. Religiöse Menschen finden darin eine Bestätigung ihrer eigenen Weltordnung, während Theoklasten (wie ich einer bin) darin nur Wiederholung sehen. The VVitch hätte den Mut haben können, diesen Glauben zu unterlaufen. Stattdessen bestätigt er ihn. Das ist die Ironie vieler amerikanischer Produktionen: Sie predigen Aufklärung, aber sie enden in der alten Furcht vor der Hölle.
Filme über Satan können durchaus faszinieren, auch die übernatürlichen. Doch sie müssen es mit Intelligenz tun, nicht mit Dogma. Angel Heart hat das verstanden. Dort wird das Übernatürliche nicht als Beweis verkauft, sondern als Versuchung. Als Spiegel der Schuld, die in jedem Menschen wohnt. Das ist der Unterschied zwischen Kino und Katechismus.
Überleitung zu Teil III: Satanische Hysterie
Die Dämonenmaschine Hollywoods drehte sich weiter, bis die Fiktion die Realität einholte. Als religiöse Angst und Unterhaltung verschmolzen, entstand eine neue Form der Panik. Was als Film begann, verwandelte sich in gesellschaftliche Hysterie, in moralische Prozesse und in Schlagzeilen. Aus dem Symbol wurde Verdacht, aus dem Kino wurde Gerichtssaal. Hier beginnt die letzte Stufe der Projektion. Die Angst verlässt die Leinwand und sucht sich ein neues Opfer.
Quellen
- They were talked about… and they were out there. Witchcraft in the Pyrenees and western districts
- Stereotypes about the inquisitorial persecution of witchcraft
- Rosemary’s Baby: No 2 best horror film of all time
- The Devil’s Surprise / Satan’s seductions are subtle, and satisfying in `Advocate‘
- From Rosemary’s Baby to Hereditary: why the creepy cult in horror refuses to die
- “I Know Who I Am!”: The Shifting Identities of ‘Angel Heart’
- Evil and Anti-Christ: “The Omen” (1976) Essay (Movie Review)
- Movie Review: “The Omen” (1976)
- Madalyn Murray O’Hair: Life, Legacy, and Mysterious Disappearance
- Madalyn Murray discusses her family history, feminism, and theology
- The Woman Who Took On The Religious Right (And Died)
- Film Review: The Devil’s Advocate (1997)
- Contemporary Religious Satanism (Buch)
- The Encyclopedic Sourcebook of Satanism (Buch)
- Church of Satan
- Church of Satan: eine Kirche der Teufelsanbeter?
- Church of Satan (CoS) auf relinfo
- The Satanic Temple